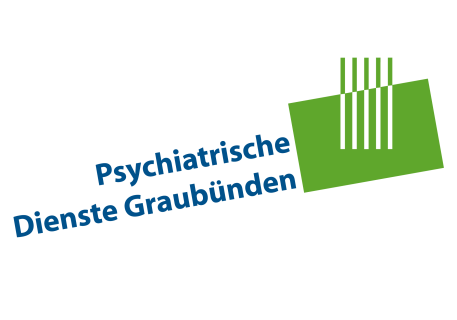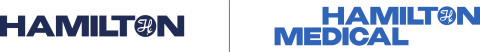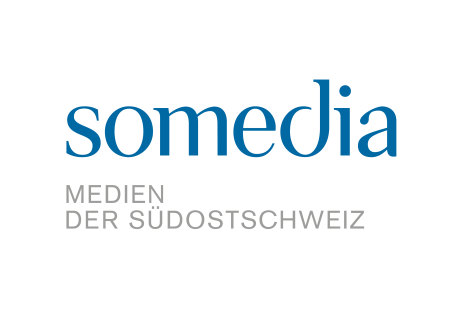Rudolf Minsch, was machen Ihre drei Kinder heute beruflich bzw. in Ausbildung?
Zwei sind noch in der Ausbildung. Der Älteste hat gerade das Studium abgeschlossen und ist derzeit auf der Suche nach einer passenden fixen Stelle.
Wie haben Sie persönlich den Prozess der Berufswahl Ihrer Kinder erlebt?
Meine beiden älteren Kinder haben das Gymnasium besucht und mussten sich sehr lange nicht entscheiden, was sie machen wollen. Meine Jüngste hingegen wollte eine Lehre machen und hat sich schon früh mit der Berufswahl auseinandergesetzt. Sie hat während dieses Prozesses und dann auch vor allem während der Lehre eine sehr positive Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht. Sie hat dadurch früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und im Team zu arbeiten. Die beiden Älteren taten sich lange schwer, ihren beruflichen Weg zu finden. Es wäre aus meiner Sicht dringend nötig, den Berufswahlunterricht inklusive Schnupperlehren auch für Jugendliche für obligatorisch zu erklären, die eine vollschulische Ausbildung machen. Im Nachhinein hätte ich den beiden Älteren stärker nahelegen müssen, auch eine Berufslehre in Betracht zu ziehen.
Wie beurteilen Sie heute die beruflichen Aussichten?
Der demographische Wandel spielt in die Karten der jungen Generation. Der Fachkräftemangel sorgt für vielfältige Einstiegsmöglichkeiten ins Erwerbsleben und auch die Aussichten für eine interessante Karriere sind gut. Doch auch die Jungen müssen sich behaupten und gute Leistungen aufweisen, um ihren Weg zu machen. Man muss aber sagen, dass es ein Privileg ist, in der Schweiz zu leben. Wir haben vielfältige und sehr interessante Beschäftigungsmöglichkeiten in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind offen.
War Ihre berufliche Laufbahn vorgegeben?
Überhaupt nicht. Weil mein Bruder den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernehmen wollte, konnte ich frei wählen, was ich machen wollte. Ich besuchte in Schiers das Untergymnasium, wollte dann aber Primarlehrer werden. Nach drei Jahren als Lehrer entschied ich mich, ein Studium an der HSG zu machen. Von da an ging es ziemlich gradlinig. Studium der Volkswirtschaftslehre, Weiterbildung am Studienzentrum Gerzensee, Doktorat an der HSG und Forschungsaufenthalt an der Boston University. Ich hatte den Vorteil, dass ich jeweils selber entscheiden konnte, auch wenn mir die Eltern oder das Umfeld hie und da auch ganz andere Ratschläge erteilten.
Welchen Einfluss hat Bildung auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes?
Bildung ist die wichtigste Ressource der Volkswirtschaft. Sie bildet das Fundament für exzellente Forschung, Innovation und damit für die Wettbewerbsfähigkeit einer Nation. Eine starke Bildung sichert die Grundkompetenzen in der Gesellschaft und schafft die Voraussetzung für lebenslanges Lernen. Dadurch können Menschen auf Veränderungen, wie etwa die Digitalisierung, reagieren, sich weiterentwickeln und stets bedarfsgerecht im Einklang mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes aus- und weitergebildet werden.
Die Berufsbildung in der Schweiz gilt als Erfolgsmodell. Warum wird unser System im Inland geschätzt und im Ausland bewundert?
Die Berufsbildung ist praxisorientiert und vermittelt jungen Menschen eine arbeitsmarktrelevante Ausbildung. Sie lässt sich kontinuierlich an Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitsmarkt anpassen und weiterentwickeln. Mit der höheren Berufsbildung, der Berufsmatura und dem Zugang zu Fachhochschulen bietet sie zudem eine hervorragende Grundlage, um sich auch auf tertiärer Ebene weiterzubilden. Damit verfügt die Schweiz über ein stark durchlässiges Bildungssystem, das sicherstellt, dass jede Ausbildung Anschlussmöglichkeiten eröffnet. Das duale Berufsbildungssystem und der hohe Anteil an Jugendlichen, rund zwei Drittel, die diesen Weg wählen, werden häufig als mögliche Erklärung für die im internationalen Vergleich tiefe Jugenderwerbslosigkeit genannt.
Warum ist denn das Ansehen der Berufsbildung im Vergleich zur akademischen Laufbahn in vielen Kreisen tiefer?
Vor allem in den Köpfen vieler Eltern, insbesondere jener mit Migrationshintergrund, erscheint die Berufsbildung oft wenig attraktiv. Häufig ist ihnen die Durchlässigkeit des Bildungssystems sowie die Tatsache, dass mit einem Berufsbildungsabschluss wettbewerbsfähige Löhne erzielt werden können und eine tolle Karriere möglich ist, nicht ausreichend bekannt. Eltern haben zudem einen erheblichen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder.
Wie durchlässig ist unser Bildungssystem tatsächlich? Gibt es dazu belastbare Studien?
Ein spezifisches Mass für die Durchlässigkeit des Bildungssystems existiert nicht. Die Studie von Patrick Chuard-Keller und Veronica Grassi «Switzer-Land of Opportunity: Intergenerational Income Mobility in the Land of Vocational Education» [1] zeigt jedoch eindrücklich, dass die Schweiz trotz einer im Vergleich eher geringen Bildungsmobilität über eine sehr hohe Einkommensmobilität verfügt. Dies wird auf das duale Berufsbildungssystem und die hohe Durchlässigkeit des Bildungssystems zurückgeführt. Für das Einkommen spielt es vergleichsweise eine geringe Rolle, ob Jugendliche eine Universität besuchen oder ihren Bildungsweg über die Berufsbildung einschlagen.
Wie wichtig ist die Berufsbildung für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Schweiz?
Die Bedeutung kann nicht überschätzt werden. Die Berufsbildung zeichnet sich durch ihre starke Arbeitsmarktnähe aus und sorgt für einen kontinuierlichen Wissenstransfer zwischen Praxis und Bildung. Insbesondere über die höhere Berufsbildung und die Fachhochschulen können Mitarbeitende berufsbegleitend studieren und neu erworbenes Wissen direkt in ihren Arbeitsalltag einbringen. Es zeigt sich zudem, dass Personen, die früh in den Arbeitsmarkt einsteigen, tendenziell innovativer und unternehmerischer sind. Damit trägt die Berufsbildung entscheidend dazu bei, dass Unternehmen innovativ bleiben und sich rasch an wirtschaftliche Veränderungen anpassen können.
Viele Lehrberufe von früher sind verschwunden, gleichzeitig entstehen laufend neue. Ist die Berufsbildung ausreichend für die Zukunft gerüstet?
Das verdeutlicht, wie stark die Berufsbildung am Bedarf des Arbeitsmarkts ausgerichtet ist. Junge Menschen werden genau in jenen Kompetenzen ausgebildet, die später nachgefragt werden, das macht das System ausgesprochen effizient. Durch ihre enge Praxisnähe steht die Berufsbildung in ständigem Austausch mit den sich wandelnden Anforderungen der Wirtschaft und kann entsprechend flexibel angepasst werden. Entscheidend ist, dass Unternehmen auch künftig einen ausreichenden Anreiz haben, genügend Lehrstellen bereitzustellen, um den Nachwuchs an Fachkräften zu sichern. Dafür braucht es Rahmenbedingungen, die den Branchen und Betrieben genügend Handlungsspielraum lassen. Subventionen oder staatliche Bevormundung hingegen wären der falsche Ansatz.
Wie werden technologische Entwicklungen die Bildung selbst verändern? Was erwarten Sie konkret für die Berufsbildung?
Gerade die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz wird Schulen und die darauf aufbauende Berufsbildung herausfordern, den Lernprozess wieder stärker ins Zentrum zu rücken. Da KI in der Lage ist, ganze Arbeiten oder Projekte zu erstellen, wird es entscheidend sein, den Lernprozess eng zu begleiten. Lernende sollen nachvollziehbar darlegen und mündlich erklären können, wie sie zu Ergebnissen gekommen sind und was sie dabei gelernt haben. Lernende müssen nicht nur den sicheren Umgang mit digitalen Tools und KI beherrschen, sondern auch die Fähigkeit entwickeln, kritisch zu reflektieren und Informationen einzuordnen. Starke Grundkompetenzen und solides Fachwissen sind daher wichtiger denn je, denn nur wer selbst über Wissen verfügt, kann beurteilen, ob KI-generierte Inhalte korrekt und verlässlich sind. Für die Berufsbildung bedeutet das, dass neben der praxisnahen Ausbildung der kritische Umgang mit neuen Technologien sowie die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen noch stärker in den Vordergrund rücken werden.
Müssen Ausbildungsgänge und Lehrpläne künftig noch schneller und flexibler angepasst werden?
Es ist zweifellos wichtig, dass Ausbildungsgänge laufend an die aktuellen Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst und weiterentwickelt werden. Auch die Lehrpläne müssen flexibel auf Veränderungen reagieren können. Entscheidend ist jedoch, dass diese Anpassungen sachlich und nicht ideologisch geprägt sind. Die Schule sollte vor allem sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit über solide Grundkompetenzen verfügen und in der Lage sind, Informationen kritisch zu hinterfragen. Dies bildet das Fundament für alle weiteren Aus- und Weiterbildungen.
Kommen wir nun zur Arbeits- und Berufswelt der Zukunft. Welche Berufe gibt es 2050 nicht mehr?
Es ist hinlänglich bekannt, dass gerade repetitive Tätigkeiten, sowohl manuelle als auch kognitive, am stärksten von Künstlicher Intelligenz und der Technologisierung betroffen sein werden. Berufe, die sich durch stark standardisierte, wiederkehrende Aufgaben auszeichnen, werden daher bis 2050 wahrscheinlich stark zurückgehen oder sich grundlegend verändern. Dazu zählen zum Beispiel einfache Datenerfassungs- oder Verwaltungsaufgaben, standardisierte Produktionsarbeiten oder Routineprozesse im Büro bis hin zu juristischen Dienstleistungen.
In welchen Bereichen werden neue Berufe entstehen?
Neue Berufe werden vor allem in Bereichen entstehen, die Kreativität, komplexe Problemlösung, soziale Interaktion oder kritisches Denken erfordern, alles Fähigkeiten, die auch durch KI nur schwer ersetzt werden können. Zudem wird der Umgang mit der stetig wachsenden Datenmenge eine zentrale Rolle spielen. Entsprechend werden Berufe in den Bereichen Datenanalyse, Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit, digitale Transformation, aber auch in interdisziplinären Innovations- und Beratungsfunktionen weiter an Bedeutung gewinnen.
Können Sie konkrete Beispiele machen, wie KI die Arbeitswelt bereits heute verändert?
KI verändert die Arbeitswelt bereits heute in vielen Bereichen spürbar. In Banken werden etwa Prozesse automatisiert, Chatbots übernehmen Kundenanfragen, und Roboadvisors unterstützen bei der Anlageberatung. KI übernimmt juristische Recherchen oder vereinfacht Verwaltungsaufgaben. In der Industrie werden Produktionsabläufe optimiert und Qualitätssicherung durch KI-gestützte Systeme verbessert. Auch im Gesundheitswesen kommen KI-Anwendungen bei der Diagnostik oder beim Protokollieren und Dokumentieren von Patientengesprächen zum Einsatz. Selbst im Büroalltag erleichtern intelligente Assistenzsysteme das Sortieren und Auswerten von Daten, automatisieren Routineaufgaben und unterstützen Mitarbeitende bei Entscheidungsprozessen. Zudem wird KI die Arbeit individueller, flexibler und produktiver machen, indem sie gezielt Lern- und Entscheidungsprozesse unterstützt.
Werden technologische Entwicklung nicht vielfach überschätzt? Wird KI die Arbeitswelt so stark verändern, wie vielfach behauptet?
Künstliche Intelligenz wird sicherlich einige Veränderungen in der Arbeitswelt mit sich bringen, und wie bereits erwähnt, werden bestimmte Stellen stärker betroffen sein als andere, vor allem repetitive Tätigkeiten. Vor allem aber ist KI bereits heute ein wertvolles Hilfsmittel und wird dies auch künftig bleiben: Sie unterstützt uns bei der täglichen Arbeit, erleichtert Prozesse und steigert unsere Produktivität. Die Veränderungen werden also da sein, aber KI ist eher ein Werkzeug zur Effizienzsteigerung und Unterstützung, weniger ein allumfassender Ersatz menschlicher Arbeit.
Mit KI ist das Wissen noch einfacher und schneller verfügbar. Braucht es künftig gar nicht mehr so viel Bildung, da sich jede und jeder die Informationen schnell beschaffen kann?
Im Gegenteil: Wissen wird durch KI wichtiger denn je. Denn gerade durch Tools wie ChatGPT kursieren auch viele Falschinformationen, die Lernende erkennen und einordnen müssen. Dafür ist kritisches Denkvermögen unerlässlich. Gleichzeitig sollte KI als Lernmittel eingesetzt werden: Sie ermöglicht ein individuell angepasstes, sogenanntes adaptives Lernen. Die KI kann genau erfassen, was die Lernenden bereits können und in welchen Bereichen sie noch Unterstützung oder Übung benötigen. So wird Bildung nicht weniger, sondern zielgerichteter und effektiver, weil Lernprozesse gezielt begleitet und Lernende dort gefördert werden, wo sie es am meisten brauchen.
Wird KI aufgrund der Effizienzsteigerungen den Fachkräftemangel entschärfen können?
In Bereichen wie der Ausbildung, also Lehrkräfte, und im Gesundheitswesen, etwa Ärzte und Pflegefachkräfte, wird sich der Fachkräftemangel durch KI kaum entschärfen. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in diesen Bereichen weiterhin hoch bleiben. Sicherlich werden KI-Anwendungen in vielen Berufen zu Produktivitätssteigerungen führen. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen aber auch, dass der Wegfall bestimmter Jobs in der Regel auch neue Tätigkeiten schafft. Damit die Arbeitskräfte diesen neuen Anforderungen gerecht werden, ist eine gezielte Aus- und Weiterbildung entscheidend. KI kann unterstützen, entlasten und Prozesse effizienter gestalten, sie ersetzt aber nicht den Bedarf an gut ausgebildeten Menschen in zentralen Berufsfeldern. Und es ist notwendig, dass die öffentliche Verwaltung ebenfalls KI zur Effizienzsteigerung nutzt und die Tendenz umgekehrt wird, dass immer mehr Verwaltungsstellen geschaffen werden.
Was sind die Nachteile von KI für die Wirtschaft?
KI bringt für die Wirtschaft viele Chancen, birgt aber auch Risiken, wenn sie unkritisch eingesetzt wird. So können Falschinformationen oder fehlerhafte Analysen die Entscheidungsfindung beeinträchtigen, wenn Mitarbeitende nicht ausreichend geschult sind, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Ausserdem müssen Aus- und Weiterbildungen an die veränderten Anforderungen durch KI angepasst werden. Geschieht dies nicht, drohen Qualifikationslücken und ineffiziente Prozesse. Hinzu kommen Datenschutz- und Sicherheitsrisiken: KI-Systeme verarbeiten grosse Mengen sensibler Daten, die bei unzureichendem Schutz missbraucht oder gehackt werden könnten. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass Datenintegrität, Vertraulichkeit und Compliance jederzeit gewährleistet sind.
Was würden Sie jungen Menschen aufgrund der kommenden technologischen Veränderungen raten, die heute vor der Entscheidung stehen: Lehre oder Studium?
Berufserfahrung bleibt heute wie in Zukunft entscheidend für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Die Berufslehre bietet eine praxisnahe Ausbildung, die den direkten Einstieg in die Arbeitswelt ermöglicht und zugleich Wege zur höheren Berufsbildung oder über die Berufsmatura an die Fachhochschule eröffnet, oft berufsbegleitend. Eine aktuelle Studie des BSS zeigt zudem, dass gerade mit der höheren Berufsbildung sehr hohe Bildungsrenditen erzielt, werden können. Damit ist gemeint, dass der finanzielle Nutzen einer Aus- oder Weiterbildung die Ausbildungskosten übertrifft, auch wenn man die Zeit, welche dafür aufgewendet wird, miteinberechnet. Damit ist gemeint, dass der finanzielle Nutzen einer Aus- oder Weiterbildung die Ausbildungskosten übertrifft, auch wenn man die Zeit, welche dafür aufgewendet wird, miteinberechnet. Ist das so ok für Sie? Generell sind die Lohnunterschiede zwischen den tertiären Abschlüssen, sprich höhere Berufsbildung, Fachhochschule oder Universität, vergleichsweise gering. Vor diesem Hintergrund würde ich jungen Menschen raten, eine Entscheidung nicht allein nach dem Abschluss, sondern vor allem nach ihren Interessen, Stärken und Lernpräferenzen zu treffen. Sowohl eine berufliche Grundbildung als auch ein Studium können hervorragende Grundlagen bieten, um sich an die technologischen Veränderungen der Zukunft anzupassen. Wichtig ist, dass sie währenddessen praktische Erfahrung sammeln und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln.
Welche Weichen müssen heute gestellt werden, damit die Berufsbildung auch in 20 Jahren noch ein Erfolgsmodell ist?
Damit die Berufsbildung ein Erfolgsmodell bleibt, braucht es vor allem Aufklärungsarbeit bei den Eltern: Sie müssen erkennen, wie attraktiv die duale Berufslehre ist und wie durchlässig das Schweizer Bildungssystem tatsächlich ist. Ziel ist nicht, die Maturitätsquote weiter zu erhöhen, und auch ein weiterer Ausbau der Fachmittelschulen (FMS) ist aus Sicht der Wirtschaft nicht sinnvoll. Abgesehen vom Zugang zur Primarlehrausbildung ist dieses Format aufgrund der Praxisferne wenig zielführend. Gleichzeitig müssen die Branchen und Lehrbetriebe wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen haben, damit sie genügend Lehrstellen anbieten können. Vorgaben wie acht Wochen Ferien für Lernende wirken in diesem Kontext kontraproduktiv. Entscheidend ist, dass die Berufsbildung praxisnah bleibt, junge Menschen optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet und gleichzeitig flexibel auf Veränderungen reagieren kann.